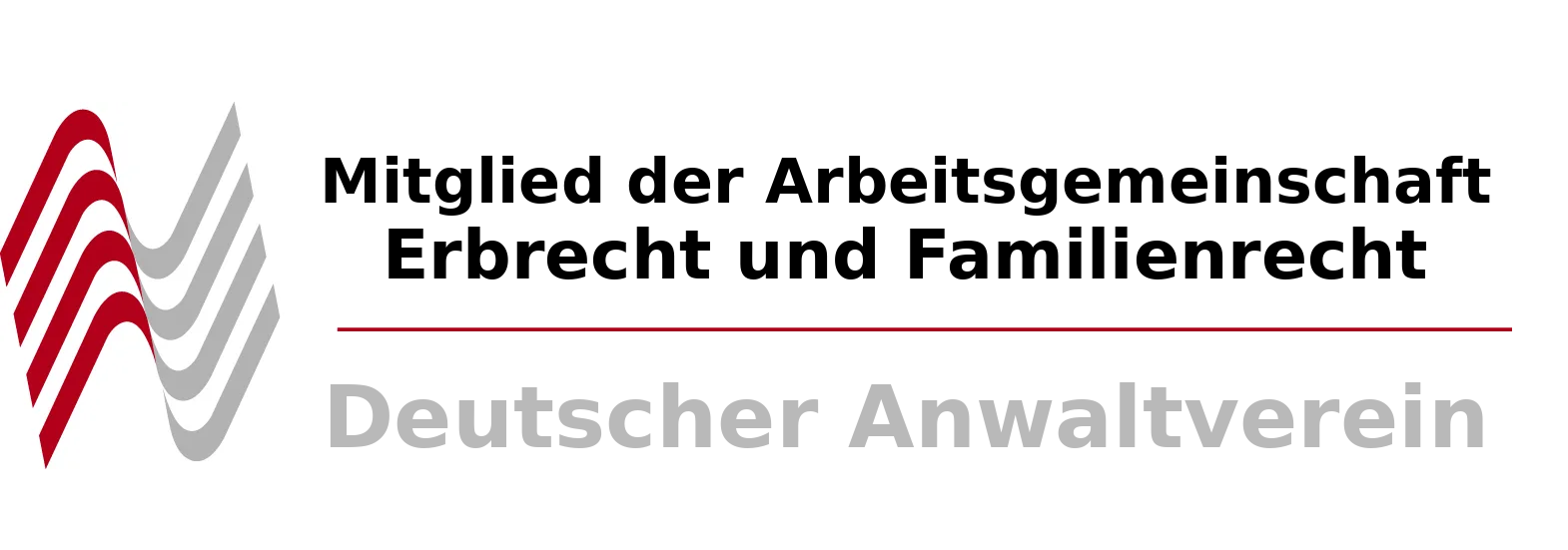Ihr Anspruch auf den Pflichtteil
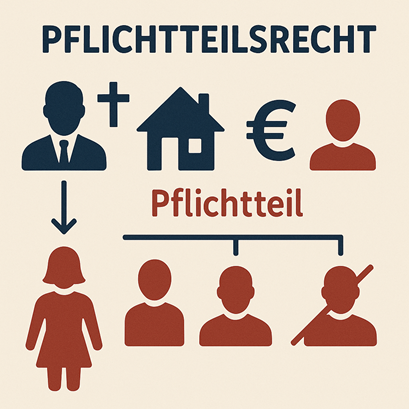 Das Pflichtteilsrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Erbrechts. Es soll sicherstellen, dass nahe Angehörige auch dann einen Mindestanteil am Nachlass erhalten, wenn sie im Testament oder Erbvertrag nicht bedacht oder enterbt wurden. Für viele Betroffene ist es die einzige Möglichkeit, nach dem Tod eines nahen Angehörigen einen gerechten Anteil am Erbe zu erhalten.
Das Pflichtteilsrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Erbrechts. Es soll sicherstellen, dass nahe Angehörige auch dann einen Mindestanteil am Nachlass erhalten, wenn sie im Testament oder Erbvertrag nicht bedacht oder enterbt wurden. Für viele Betroffene ist es die einzige Möglichkeit, nach dem Tod eines nahen Angehörigen einen gerechten Anteil am Erbe zu erhalten.
Wer ist pflichtteilsberechtigt?
Nach den §§ 2303 ff. BGB haben folgende Personen einen Pflichtteilsanspruch:
- Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner
- Kinder – hierzu gehören eheliche und nichteheliche Kinder gleichermaßen, ebenso adoptierte Kinder
- Kindeskinder (wenn das Kind vorverstorben ist)
- Eltern, sofern keine Abkömmlinge vorhanden sind
Wichtig: Seit der gesetzlichen Gleichstellung sind nichteheliche Kinder den ehelichen Kindern vollständig gleichgestellt. Sie haben denselben Pflichtteilsanspruch, unabhängig davon, ob sie vor oder während einer Ehe geboren wurden.
Nicht pflichtteilsberechtigt sind dagegen entferntere Verwandte wie Geschwister oder Enkel, solange deren Eltern noch leben.
Höhe des Pflichtteils
Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Beispiel:
Wäre ein Kind nach der gesetzlichen Erbfolge mit ¼ am Nachlass beteiligt, so würde sein Pflichtteil 1/8 des Nachlasswertes betragen.
Die Berechnung des Pflichtteils hängt somit von zwei Faktoren ab:
1. Der gesetzlichen Erbquote
2. Dem Wert des Nachlasses zum Todeszeitpunkt
Berechnung des Nachlasswerts
Für die Pflichtteilsberechnung ist der Reinnachlass entscheidend: Aktiva (z. B. Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere) abzüglich Beerdigungskosten und Nachlassverbindlichkeiten = Nachlasswert.
Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB)
Besonders konfliktträchtig ist der sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dieser kommt dann in Betracht, wenn der Erblasser zu Lebzeiten Schenkungen vorgenommen hat, die den Nachlasswert vermindern.
Grundprinzip:
Pflichtteilsberechtigte sollen davor geschützt werden, dass ihr Anspruch durch lebzeitige Übertragungen des Erblassers umgangen wird. Deshalb wird der Wert bestimmter Schenkungen dem Nachlass rechnerisch wieder hinzugerechnet.
10-Jahres-Frist:
- Schenkungen werden berücksichtigt, wenn sie innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Tod erfolgt sind.
- Für jedes volle Jahr, das seit der Schenkung vergangen ist, reduziert sich der anzusetzende Wert um 10 % (Abschmelzungsmodell).
- Nach Ablauf von 10 Jahren bleibt die Schenkung unberücksichtigt.
Beispiel:
Überträgt der Erblasser seinem Sohn 8 Jahre vor seinem Tod ein Grundstück im Wert von 100.000 €, so sind noch 20 % (= 20.000 €) dieses Werts dem Nachlass hinzuzurechnen.
Typische Fälle aus der Praxis:
- Übertragung von Immobilien an Kinder „mit Rücksicht auf das künftige Erbe“
- Schenkungen kurz vor dem Tod (z. B. hohe Geldbeträge, Übertragung von Konten)
- Unternehmensnachfolge durch lebzeitige Übertragung von GmbH-Anteilen
Besonderheiten bei Ehegatten:
Hat ein Ehegatte dem anderen eine Schenkung gemacht (z. B. Übertragung einer Immobilie oder Geld), beginnt die 10-Jahres-Frist erst mit der Auflösung der Ehe (durch Tod oder Scheidung). Damit werden solche Schenkungen voll berücksichtigt – selbst wenn sie länger als 10 Jahre zurückliegen.
In all diesen Konstellationen entstehen regelmäßig erhebliche Pflichtteils- und Pflichteisergänzungsansprüche, die oft nur mit anwaltlicher Hilfe durchgesetzt oder abgewehrt werden können.
Durchsetzung des Pflichtteils
Pflichtteilsberechtigte haben zunächst einen Auskunftsanspruch (§ 2314 BGB). Der Erbe muss ein vollständiges Nachlassverzeichnis erstellen, ggf. auch mit Unterstützung eines Notars. Dieses Verzeichnis muss auch Schenkungen der letzten 10 Jahre enthalten, bzw. bei Ehegatten ab dem Hochzeitstag.
Pflichtteilsberechtigte haben neben dem Auskunftsanspruch auch einen Anspruch auf Wertermittlung. Nach § 2314 BGB können sie verlangen, dass der Wert einzelner Nachlassgegenstände durch ein Sachverständigengutachten festgestellt wird. Dieser Anspruch dient dazu, Immobilien, Unternehmen oder wertvolle Sammlungen realistisch zu bewerten und eine zutreffende Pflichtteilsberechnung zu ermöglichen.
In der Praxis wird der Wertermittlungsanspruch häufig bei folgenden Nachlassgegenständen geltend gemacht:
- Immobilien (Wohnhäuser, Grundstücke)
- Unternehmensbeteiligungen
- Wertvolle Kunstwerke, Antiquitäten oder Sammlungen
Die Kosten für die Wertermittlung trägt grundsätzlich der Nachlass. So wird sichergestellt, dass Pflichtteilsberechtigte nicht an einer effektiven Durchsetzung ihrer Ansprüche gehindert werden.
Im Anschluss erfolgt die Pflichtteilsberechnung und ggf. die außergerichtliche oder gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche. Erfahrungsgemäß kommt es gerade hier oft zu Konflikten – insbesondere über den Wert von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder die Anrechnung von Schenkungen.
Ihre Vorteile mit anwaltlicher Unterstützung
- Prüfung der Pflichtteilsberechtigung
- Berechnung und Geltendmachung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen
- Erstellung oder Kontrolle von Nachlassverzeichnissen
- Bewertung von Immobilien, Unternehmen und Schenkungen
- Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber den Erben
- Abwehr überhöhter Pflichtteilsforderungen
Fazit
Das Pflichtteilsrecht – insbesondere der Pflichtteilsergänzungsanspruch – ist komplex und führt häufig zu Streit innerhalb der Familie. Gerade bei größeren Nachlässen, Immobilien oder lebzeitigen Schenkungen ist anwaltliche Unterstützung entscheidend, um die eigenen Rechte zu sichern.
Als Fachanwalt für Erbrecht mit Kanzleisitz in Schierling und Hengersberg berate und vertrete ich Sie umfassend bei der Durchsetzung oder Abwehr von Pflichtteilsansprüchen. Vereinbaren Sie gerne hier Termin in meiner Kanzlei in Schierling oder Hengersberg, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.