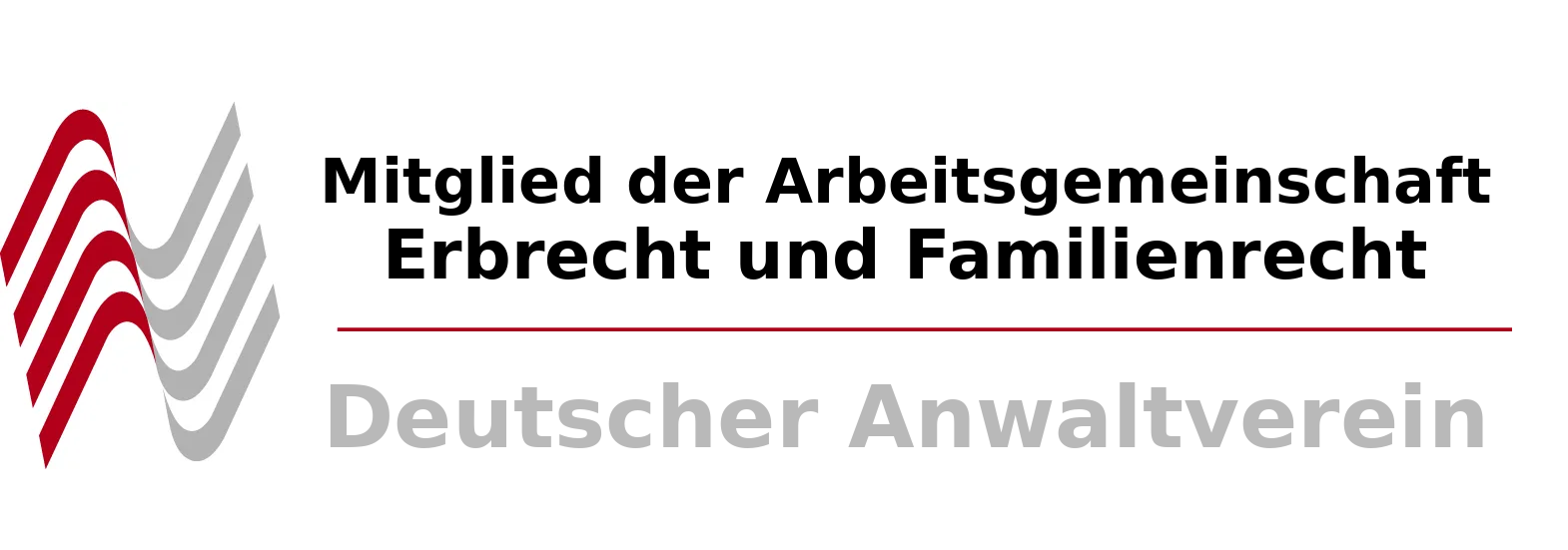Anfechtung Hauskauf wegen falscher Maklerangaben?
Wer ein gebrauchtes Haus kauft, liest häufig im notariellen Kaufvertrag den Satz „gekauft wie gesehen“ oder einen weitgehenden Ausschluss der Gewährleistung. Viele Käufer gehen dann davon aus: Wenn später Probleme auftauchen, habe ich „Pech gehabt“. Ein aktueller Fall vor dem Landgericht Frankenthal zeigt jedoch, dass es Ausnahmen geben kann – insbesondere dann, wenn wesentliche Informationen verschwiegen oder Angaben im Maklerexposé objektiv irreführend sind.
Worum ging es in dem Fall?
Eine Käuferin erwarb ein Anwesen (Kaufpreis: über 600.000 Euro). Im Maklerexposé wurde das Haus unter anderem als „liebevoll kernsaniert“ beschrieben. Nach dem Kauf traten zwei zentrale Probleme auf:
- Baugenehmigung/baurechtlicher Konflikt:
Die Verkäuferin hatte wenige Monate vor dem Verkauf bereits Kontakt mit der Stadtverwaltung. Dabei kam zur Sprache, dass für eine Außentreppe und eine Terrasse keine Baugenehmigung bestand. Nach dem Verkauf forderte die Stadtverwaltung die Käuferin auf, Terrasse und Außentreppe zu beseitigen – unter anderem, weil diese unzulässig (auf dem Nachbargrundstück) errichtet worden waren. - Technischer Zustand (Elektro):
Ein Elektriker bewertete die Elektroinstallation nicht als „neuwertig“, sondern als Technikstand der 1990er Jahre. Das passte aus Sicht der Käuferin nicht zu dem Eindruck, den der Begriff „Kernsanierung“ vermittelt.
Die Käuferin wollte sich deshalb vom Kauf lösen und erklärte die Anfechtung wegen Täuschung (vereinfacht: „Ich habe gekauft, weil ich von falschen/verschwiegenen Umständen ausgegangen bin“). Zusätzlich erklärte sie hilfsweise den Rücktritt.
Wie hat das Gericht entschieden?
Das Landgericht Frankenthal gab der Käuferin Recht.
Kernpunkte in verständlicher Sprache:
- Verschweigen wichtiger Informationen kann entscheidend sein.
Wenn dem Verkäufer ein erheblicher Konflikt mit Behörden bekannt ist (hier: fehlende Genehmigung, mögliche Beseitigungsanordnung), muss er das nicht „unter den Tisch fallen lassen“. Ein solches Verschweigen kann den Käufer in die Irre führen.
- Ein Maklerexposé kann dem Verkäufer zugerechnet werden.
Das Gericht wertete die Beschreibung im Exposé wie eine Aussage des Verkäufers. Das ist praktisch bedeutsam: Auch wenn die Formulierungen „nur im Exposé“ stehen, können sie rechtlich relevant sein, wenn der Verkäufer dahintersteht bzw. sie als Grundlage des Verkaufs dienen. - „Kernsanierung“ ist kein beliebiges Werbewort.
Nach dem Gericht setzt „Kernsanierung“ nach allgemeinem Sprachgebrauch voraus, dass die Bausubstanz in einen nahezu neuwertigen Zustand versetzt wurde. Wenn dann wesentliche Teile (wie hier: Elektroinstallation) nicht diesem Eindruck entsprechen und Zweifel nicht ausgeräumt werden, kann die Beschreibung als irreführend bewertet werden. - Gewährleistungsausschluss schützt nicht bei Täuschung.
Ein vertraglicher Haftungsausschluss hilft dem Verkäufer nicht, wenn er den Käufer durch Verschweigen oder irreführende Angaben zum Vertragsschluss bewegt hat – insbesondere, wenn er die Renovierungen selbst verantwortet und den tatsächlichen Zustand kennt.
Folge: Die Käuferin durfte nach der Entscheidung ihr Geld gegen Rückgabe des Hauses verlangen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig; es wurde Berufung zum OLG Zweibrücken eingelegt.
Was bedeutet das für Käufer in der Praxis?
- Exposé ernst nehmen – und sichern.
Speichere Exposé, Online-Anzeige, E-Mails, Chatverläufe. Wenn später Streit entsteht, ist das oft die wichtigste Grundlage.
- Bei „kernsaniert“, „neuwertig“, „top Zustand“ konkret nachfragen.
Frage nach: Welche Gewerke wurden wann gemacht (Elektro, Dach, Heizung, Leitungen, Fenster)? Gibt es Rechnungen, Abnahmen, Prüfprotokolle? - Behörden-/Genehmigungsthemen aktiv abklären.
Terrassen, Anbauten, Dachausbauten, Außentreppen, Stellplätze: Nicht alles ist automatisch genehmigt. Im Zweifel beim Bauamt nachfragen oder Einsicht in Bauakte/Bescheide. - Technik-Check vor dem Kauf kann viel Geld sparen.
Gerade Elektro/Heizung/Dach sind typische Kostentreiber. Ein kurzer Vor-Ort-Termin mit Sachverständigem oder Handwerker kann sich lohnen.
- Nicht vorschnell resignieren, nur weil „Gewährleistung ausgeschlossen“ im Vertrag steht.
Ein Ausschluss ist häufig wirksam – aber nicht grenzenlos. Wenn zentrale Tatsachen verschwiegen oder „schöngefärbt“ wurden, kann eine Lösung vom Vertrag trotzdem möglich sein.
Und für Verkäufer?
Wer verkauft, sollte bekannte Problemfelder (Genehmigungen, Streit mit Behörden/Nachbarn, gravierende Mängel) offen ansprechen und Aussagen im Exposé nur dann verwenden, wenn sie belastbar sind. Sonst drohen teure Rückabwicklungen – selbst bei vermeintlich „wasserdichtem“ Haftungsausschluss.
Unsere Empfehlung: Lassen Sie den Kaufvertrag bereits vor der Unterzeichnung prüfen. In unserer Kanzlei analysieren wir Ihren Vertrag auf mögliche Risiken und beraten Sie umfassend zu Ihren Rechten und Pflichten. Vereinbaren Sie gerne hier einen Beratungstermin.
Ablauf einer Scheidung – Fachanwalt für Familienrecht
Eine Scheidung ist selten nur ein formaler Akt. Häufig müssen parallel Unterhalt, Vermögen, Wohnung oder Immobilie sowie – bei Kindern – tragfähige Betreuungs- und Umgangsregelungen geordnet werden. Entscheidend ist, frühzeitig Struktur in die rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu bringen, damit das Verfahren planbar bleibt und Folgestreitigkeiten vermieden werden, soweit dies im konkreten Fall möglich ist.
Wir beraten und vertreten Mandanten am Standort Schierling und Umfebung, insbesondere in den Gemeinden Langquaid und Mallersdorf-Pfaffenberg.
Online-Termin buchen
Wenn Sie eine Erstberatung zur Scheidung wünschen, können Sie einen Termin online vereinbaren. Im Ersttermin erhälten Sie einen belastbaren Fahrplan (nächste Schritte, Unterlagenliste, Prioritäten).
Wann ist eine Scheidung möglich?
Scheitern der Ehe (rechtliche Grundlage)
Voraussetzung der Scheidung ist, dass die Ehe gescheitert ist, also eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann (§ 1565 Abs. 1 BGB). In der Praxis steht nicht „Schuld“ im Vordergrund, sondern eine nachvollziehbare Darstellung der Trennung und ihrer Dauer. Je klarer die tatsächliche Trennung beschrieben werden kann, desto reibungsloser lässt sich das Verfahren führen.
Trennungsjahr und gesetzliche Vermutungen
Bei einjähriger Trennung wird das Scheitern der Ehe vermutet, wenn beide Ehegatten die Scheidung wollen oder der andere zustimmt (§ 1566 Abs. 1 BGB). Bei dreijähriger Trennung gilt die Vermutung auch ohne Zustimmung (§ 1566 Abs. 2 BGB). Für die Verfahrensstrategie ist daher das Trennungsdatum und die Art der Trennung regelmäßig ein zentraler Punkt.
Trennung in der gemeinsamen Wohnung
Eine Trennung kann auch innerhalb derselben Wohnung möglich sein, wenn die gemeinsame Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft beendet ist. Typische Indizien sind getrennte Haushaltsführung, getrennte Finanzen, getrennte Organisation des Alltags und das Fehlen gemeinsamer Freizeit- und Versorgungsstrukturen. Im Erstgespräch klären wir, wie die Trennungssituation in deinem Fall rechtssicher einzuordnen ist und welche Darstellung gegenüber Gericht und Gegenseite zweckmäßig ist.
Ablauf des Scheidungsverfahrens – in der Praxis
1. Vorbereitung: Ziele, Prioritäten, Daten
Vor Antragstellung sollte geklärt werden, ob eine einvernehmliche Lösung realistisch ist oder ob streitige Folgesachen zu erwarten sind. Typische Konfliktfelder sind Unterhalt, Vermögen (insbesondere Immobilien), Versorgungsausgleich und – bei Kindern – Betreuung/Umgang. Eine strukturierte Vorbereitung reduziert Verzögerungen und vermeidet, dass das Verfahren durch Nebenstreitigkeiten unnötig verteuert wird.
2. Scheidungsantrag und Anwaltszwang
Der Scheidungsantrag wird durch einen Anwalt beim Familiengericht eingereicht; insoweit besteht Anwaltszwang (§ 114 Abs. 1 FamFG). Der andere Ehegatte benötigt nicht zwingend einen eigenen Anwalt, wenn er lediglich zustimmt. Ob dies in deinem Fall sinnvoll ist, hängt von der Interessenlage und den Folgesachen ab.
3. Versorgungsausgleich als Zeitfaktor
Der Versorgungsausgleich ist in den meisten Fällen Bestandteil des Scheidungsverfahrens (VersAusglG). Das Gericht holt Auskünfte bei Versorgungsträgern ein; diese Rückläufe bestimmen in der Praxis häufig die Verfahrensdauer. Vollständige Angaben und zügige Mitwirkung beschleunigen das Verfahren häufig deutlich. Ein Ausschluss oder eine Modifikation sind nur unter engen Voraussetzungen sinnvoll und rechtlich stabil zu gestalten (Einzelfallprüfung).
4. Termin und Scheidungsbeschluss
Wenn die Sache entscheidungsreif ist, setzt das Gericht den Scheidungstermin an. Dort werden Trennung und Scheitern der Ehe regelmäßig kurz thematisiert; anschließend ergeht der Scheidungsbeschluss. Vorab ist zu klären, welche Punkte vor Rechtskraft zwingend gesichert sein sollten (z. B. Unterhaltsregelungen oder Übergangslösungen bei der Wohnsituation).
Folgesachen: Was typischerweise parallel zu klären ist
Unterhalt
Während der Trennung kann Trennungsunterhalt in Betracht kommen (§ 1361 BGB). Nach der Scheidung sind nacheheliche Unterhaltsansprüche nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen möglich (§§ 1569 ff. BGB). Die entscheidenden Fragen sind regelmäßig Bedarf, Leistungsfähigkeit, Erwerbsobliegenheiten und – bei Kindern – Betreuungssituation. Eine frühzeitige, nachvollziehbare Einordnung verhindert unrealistische Erwartungen und erleichtert Einigungen.
Vermögen und Zugewinn
Ob Zugewinnausgleich relevant wird, hängt vom Güterstand und der Vermögensentwicklung während der Ehe ab. Praktisch entscheidend sind Auskunft, Stichtage sowie Bewertung (besonders bei Immobilien). Ohne belastbare Zahlen entstehen schnell verhärtete Positionen. Deshalb empfiehlt sich eine systematische Datenerhebung, bevor verhandelt oder prozessiert wird.
Kinder: Betreuung, Umgang, Kindesunterhalt
Wenn Kinder betroffen sind, geht es vor allem um tragfähige Alltagslösungen und verlässliche Kommunikation. Kindesunterhalt richtet sich nach §§ 1601 ff. BGB; Umgang nach § 1684 BGB; Sorgerecht nach §§ 1626 ff. BGB. In der Beratung wird regelmäßig geprüft, welche Regelung realistisch ist, welche Konfliktpunkte absehbar sind und ob eine außergerichtliche Einigung möglich erscheint.
Ehewohnung und Hausrat
Wohn- und Hausratsfragen sind häufig konfliktträchtig, weil sie den Alltag unmittelbar betreffen. Ungeklärte Nutzungs- und Kostenfragen schaffen schnell faktische Verhältnisse, die später nur schwer korrigierbar sind. Häufig ist eine klare, befristete Übergangsregelung der sinnvollste erste Schritt.
Scheidung mit Immobilie oder Kredit – häufige Konstellationen
Eigentum und Darlehen: zwei Ebenen
Die Scheidung ändert Eigentumsverhältnisse und Darlehensverträge nicht automatisch. Neben der Frage, wem die Immobilie gehört, ist entscheidend, wer gegenüber der Bank haftet und wer die laufenden Raten tatsächlich trägt. Daraus können interne Ausgleichsansprüche folgen. Frühzeitige Klärung und saubere Dokumentation verhindern spätere Überraschungen.
Optionen: Verkauf, Übernahme, Vermietung
Typische Lösungen sind Verkauf, Übernahme durch einen Ehegatten (mit Finanzierung/Abfindung) oder Vermietung als Zwischenlösung. Welche Option sinnvoll ist, hängt von Bonität, Liquidität, familiärer Situation und der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung ab. In der Erstberatung kann eine Entscheidungsmatrix erstellt werden: Welche Unterlagen werden benötigt, welche Schritte sind realistisch, wo liegen typische Risiken.
Kosten und Dauer – transparente Orientierung
Wie setzen sich die Kosten zusammen?
Gerichtskosten richten sich nach dem Verfahrenswert (FamGKG/GKG), Anwaltskosten nach dem RVG. Der Verfahrenswert hängt insbesondere von Einkommen und Umfang der Folgesachen ab. Eine seriöse Kosteneinordnung ist deshalb nach Aufnahme der Eckdaten möglich. Ziel ist, das Verfahren strukturiert zu führen und unnötige Nebenstreitigkeiten zu vermeiden.
Wie lange dauert eine Scheidung?
Die Dauer hängt maßgeblich davon ab, ob die Scheidung einvernehmlich geführt werden kann und wie schnell der Versorgungsausgleich bearbeitet wird (VersAusglG). Verzögerungen entstehen typischerweise durch unvollständige Angaben oder offene Folgesachen. Eine klare Priorisierung und vollständige Mitwirkung erhöhen die Planbarkeit.
Unterlagen für die Erstberatung (Orientierung)
- Eckdaten: Heiratsdatum, Trennungsdatum, Kinder (Geburtsdaten), aktuelle Wohnsituation
- Einkommen: aktuelle Nachweise, ggf. Sonderzahlungen/variable Bestandteile
- Versorgung: Renten-/Versorgungsübersichten, betriebliche/private Anrechte
- Bei Immobilie: Grundbuchdaten, Darlehensstand, Ratenhöhe, Objektunterlagen
Wenn nicht alles vorliegt, ist das kein Hindernis. Wichtig ist, dass wir eine konkrete Unterlagenliste für die nächsten Schritte erstellen.
FAQ – Scheidung in Schierling
Brauche ich für die Scheidung zwingend einen Anwalt?
Ja. Der Scheidungsantrag kann nur durch einen Anwalt gestellt werden (§ 114 Abs. 1 FamFG).
Muss das Trennungsjahr immer eingehalten werden?
Regelmäßig ja. Bei einjähriger Trennung wird das Scheitern der Ehe vermutet, wenn der andere zustimmt oder beide die Scheidung wollen (§ 1566 Abs. 1 BGB). Ausnahmen sind selten und stark einzelfallabhängig.
Was ist der Versorgungsausgleich?
Er betrifft die in der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte und wird im Scheidungsverfahren regelmäßig geprüft (VersAusglG). Er ist häufig der maßgebliche Zeitfaktor, weil Auskünfte von Versorgungsträgern eingeholt werden.
Können wir den Versorgungsausgleich ausschließen?
Das ist nur unter engen Voraussetzungen möglich (z. B. wirksame Vereinbarung) und muss rechtlich belastbar geprüft werden (Einzelfall).
Was passiert mit Haus und Kredit bei der Scheidung?
Die Scheidung ändert Eigentum und Darlehensvertrag nicht automatisch. Zu klären sind Nutzung, Ratenzahlung, Haftung gegenüber der Bank und interne Ausgleichsansprüche.
Welche Unterlagen sind für den Ersttermin sinnvoll?
Eckdaten (Heirat/Trennung/Kinder), aktuelles Einkommen und Angaben zu Renten/Versorgung. Bei Immobilie zusätzlich Grundbuch- und Darlehensdaten. Daraus lässt sich ein Fahrplan ableiten.
Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite geben eine allgemeine Orientierung und ersetzen keine Prüfung des Einzelfalls.
Häufige Fehler bei der Testamentserstellung – und wie Sie sie vermeiden
Was Verlobte vor der Ehe wissen sollten
Der Hochzeitstag ist geplant, die Gästeliste steht – und irgendwo zwischen Menüauswahl und Sitzordnung taucht eine Frage auf, die im Trubel gern untergeht: Was ändert sich rechtlich eigentlich mit der Ehe? Die Antwort ist unspektakulär und zugleich weitreichend: Mit dem Ja-Wort greifen automatisch Regeln aus Steuer-, Familien-, Renten- und Erbrecht. Viele dieser Regeln wirken im Alltag leise. Spürbar werden sie häufig erst dann, wenn Entscheidungen anstehen – beim Hauskauf, bei Elternzeit, bei Krankheit, in der Trennung oder im Todesfall.
Dieser Ratgeber soll nicht entmutigen, sondern entlasten: Wer die Mechanik kennt, kann fair gestalten, statt später unter Zeitdruck zu reagieren. Sie erhalten einen journalistisch lesbaren Überblick – mit Praxisbeispielen und einem kompakten Nachweis-Teil am Ende.
|
Kurzcheck vor der Trauung (10 Minuten) · Steuern: Zusammenveranlagung ja/nein – und welche Steuerklassen passen wirklich? · Vermögen: Wer bringt was mit (Anfangsvermögen) – und wie werden Investitionen dokumentiert? · Immobilie/Unternehmen: Schutz von Eigenkapital, Beteiligungen, Praxis/Betrieb, Erbschaften. · Rente: Versorgungsausgleich im Scheidungsfall und Hinterbliebenenrente im Todesfall. · Unterhalt: Was bedeutet Rollenverteilung (Elternzeit, Teilzeit) für Trennungs- und nachehelichen Unterhalt? · Erbrecht: Reicht die gesetzliche Erbquote – oder braucht es Testament/Erbvertrag? · Vorsorge: Wer darf im Notfall entscheiden (Notvertretung, Vollmacht, Patientenverfügung)? · Versicherung: Familienversicherung in der GKV möglich – oder private Absicherung erforderlich? · Kinder/Name: Was wird automatisch einfacher – und welche Folgen hat eine Namensänderung organisatorisch? |
1. Steuern: Warum die Ehe das Netto ändern kann – und die Steuererklärung trotzdem entscheidet
Das populärste Finanzargument für die Ehe lautet: „Dann sparen wir Steuern.“ Das kann zutreffen – insbesondere bei stark unterschiedlichen Einkommen – ist aber kein Automatismus. Steuerlich zentral ist die Wahl zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung. Bei der Zusammenveranlagung wird regelmäßig der Splittingtarif angewandt: Das gemeinsame zu versteuernde Einkommen wird rechnerisch „geteilt“, die Steuer für die Hälfte ermittelt und anschließend verdoppelt. Dadurch werden Paare mit gleichem Gesamteinkommen gleich besteuert – unabhängig davon, ob das Einkommen auf zwei Schultern verteilt ist oder überwiegend von einer Person erwirtschaftet wird.
Was viele überrascht: Die Steuerklassen (IV/IV, III/V, IV/IV mit Faktor) entscheiden vor allem über die laufende Lohnsteuer und damit über das monatliche Netto. Die endgültige Steuerlast entsteht regelmäßig erst mit der Einkommensteuerveranlagung. Wer sich nur am monatlichen Netto orientiert, riskiert Nachzahlungen.
Mini-Fall: Anna verdient 42.000 EUR brutto im Jahr, Ben 98.000 EUR. Nach der Heirat wirkt die Zusammenveranlagung typischerweise steuermindernd, weil das gemeinsame Einkommen „gleichmäßiger“ in den Tarifzonen landet. Die Wahl der Steuerklassen kann das monatliche Netto spürbar verschieben – ändert aber nicht zwingend den Jahresendbetrag. Sinnvoll ist daher, Steuerklassenwahl und erwartete Jahressteuer zusammen zu betrachten (ggf. mit Faktorverfahren).
2. Vermögen & Güterstand: Zugewinngemeinschaft heißt nicht „alles gehört beiden“
Mit der Eheschließung entsteht ohne weiteres Zutun der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das klingt nach „gemeinschaftlichem Vermögen“, bedeutet aber etwas anderes: Jeder Ehegatte bleibt Eigentümer seines Vermögens – auch dessen, was er während der Ehe erwirbt. Erst wenn der Güterstand endet (typischerweise durch Scheidung), wird bilanziert, wie stark das Vermögen beider Ehegatten während der Ehe gestiegen ist. Der Ehegatte mit dem höheren Zugewinn schuldet grundsätzlich die Hälfte der Differenz als Ausgleich.
Praktisch entscheidend ist deshalb das Anfangsvermögen. Wer mit Vermögen in die Ehe geht – Ersparnisse, Depot, Immobilie, aber auch Schulden – sollte den Stand zum Eheschließungszeitpunkt dokumentieren. Das ist keine Romantikbremse, sondern eine Beweisvorsorge für den Fall, dass Jahre später über Zahlen gestritten wird.
Mini-Fall: Eine Partnerin bringt 80.000 EUR Eigenkapital in die Finanzierung einer gemeinsamen Wohnung ein. Beide unterschreiben den Kredit, aber nur einer steht im Grundbuch. Ohne klare Dokumentation (Zahlungsflüsse, Tilgungsleistungen, Vereinbarung über Ausgleich) werden spätere Ausgleichsfragen schnell komplex – im Zugewinn, bei Nutzungsentschädigung oder bei Verkauf.
Ehevertrag? Er ist besonders dann ein sinnvolles Instrument, wenn Unternehmen, größere Vermögensunterschiede, Patchwork-Konstellationen oder eine geplante Rollenverteilung absehbar sind. Wichtig ist die Ausgewogenheit: Extrem einseitige Regelungen können rechtlich angreifbar sein und sind praktisch häufig konfliktträchtig.
3. Rente: Der Versorgungsausgleich ist der Blind Spot vieler Paare
Die langfristigste finanzielle Folge einer Ehe zeigt sich oft erst bei der Scheidung: im Versorgungsausgleich. Grundidee: Die während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften auf Altersversorgung werden grundsätzlich hälftig geteilt. Das betrifft nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern je nach Fall auch Beamtenversorgung und betriebliche Versorgungssysteme.
Mini-Fall: Ein Ehegatte arbeitet über Jahre voll, der andere reduziert wegen Kinderbetreuung. Die Rentenbiografien driften auseinander – und genau diese gemeinsame Lebensentscheidung bildet der Versorgungsausgleich typisierend ab. Wer eine klassische Rollenverteilung plant, sollte die Rentenfolgen als Teil der gemeinsamen Absicherung begreifen.
Auch im Todesfall kann die Ehe rentenrechtlich eine Rolle spielen: Bei Witwen-/Witwerrenten gilt regelmäßig eine Mindestdauer der Ehe von einem Jahr; in besonderen Ausnahmefällen (z. B. wenn der Tod nicht vorhersehbar war) kann die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe widerlegt sein.
4. Unterhalt: Pflichten entstehen nicht erst mit dem Scheidungstermin
Unterhalt wird oft erst thematisiert, wenn die Beziehung bereits in der Krise ist. Rechtlich relevant ist aber bereits die Trennung: Bis zur rechtskräftigen Scheidung kann ein Anspruch auf Trennungsunterhalt bestehen. Er knüpft an die ehelichen Lebensverhältnisse an und soll den Übergang in wirtschaftliche Selbständigkeit abfedern.
Nach der Scheidung gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Nachehelicher Unterhalt kommt typischerweise nur in gesetzlich geregelten Fallgruppen in Betracht (insbesondere Kinderbetreuung, Krankheit, Alter oder Aufstockung). Dauer und Höhe sind stark vom Lebensmodell, der Ehedauer und der Leistungsfähigkeit abhängig. Wer vor der Ehe über Rollen, Erwerbsarbeit und Familienarbeit spricht, reduziert spätere Eskalationsrisiken.
5. Erbrecht: Ohne Testament erbt der Ehegatte – aber selten „alles“
Mit der Ehe entsteht ein gesetzliches Erbrecht des Ehegatten. Die konkrete Quote hängt davon ab, ob Kinder vorhanden sind und welcher Güterstand gilt. Gerade bei gemeinsamen Kindern führt das Gesetz häufig zu einer Erbengemeinschaft, in der Ehegatte und Kinder gemeinsam entscheiden müssen – etwa über Immobilien, Konten oder den Verkauf von Vermögen.
Mini-Fall: Der Ehemann stirbt, es gibt zwei minderjährige Kinder und eine selbstgenutzte Immobilie. Ohne Testament werden Ehefrau und Kinder Miterben. Die Ehefrau verwaltet das Vermögen zwar faktisch, muss aber für wesentliche Entscheidungen rechtlich die Erbengemeinschaft im Blick behalten. Wer den überlebenden Ehegatten wirklich absichern will, benötigt häufig eine testamentarische Regelung (unter Beachtung von Pflichtteilsrechten und steuerlichen Folgen).
6. Krankheit, Bank, Behörden: Ehe bedeutet nicht automatisch Vertretungsmacht
Einer der folgenreichsten Irrtümer lautet: „Als Ehepartner darf ich automatisch alles regeln.“ Eine allgemeine Vertretungsmacht gibt es nicht. Zwar existiert für Gesundheitsangelegenheiten ein gesetzliches Ehegattennotvertretungsrecht, aber es ist an enge Voraussetzungen geknüpft, auf Gesundheitsfragen begrenzt und zeitlich befristet (maximal sechs Monate). Für Bankkonten, Immobiliengeschäfte, Behörden oder laufende Vermögensverwaltung ersetzt es keine Vorsorgevollmacht.
Praktischer Rat: Wer Risiken minimieren möchte, sollte (1) Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sauber abstimmen, (2) Bankvollmachten und Kontostruktur prüfen und (3) bei Immobilien gemeinsame Entscheidungs- und Finanzierungswege dokumentieren.
7. Kranken- und Pflegeversicherung: Ein Vorteil – aber nur unter Voraussetzungen
In der gesetzlichen Krankenversicherung kann die Ehe den Zugang zur beitragsfreien Familienversicherung eröffnen – allerdings nur, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (u. bestimmte Einkommensgrenzen und keine anderweitige vorrangige Versicherung). In der privaten Krankenversicherung gibt es hingegen keine automatische Mitversicherung; hier bleiben eigenständige Verträge und Beiträge die Regel.
8. Kinder & Name: Manche Dinge werden einfacher, anderes ist Organisationsarbeit
Wird ein Kind in der Ehe geboren, greift eine gesetzliche Zuordnung der Vaterschaft. Das reduziert Formalitäten im Vergleich zu unverheirateten Paaren. Beim Namen besteht Wahlfreiheit: Ehename oder getrennte Namensführung. Praktisch unterschätzt wird oft die Folgekette: Ausweis, Bank, Versicherungen, ggf. Berufsregister und digitale Identitäten.
9. Drei Fragen, die Verlobte sich vor der Ehe stellen sollten
- Was wäre fair, wenn wir uns in zehn Jahren trennen – finanziell und organisatorisch?
- Was passiert, wenn einer morgen ausfällt – wer darf entscheiden, wer kommt an Konten, wer unterschreibt?
- Was passiert, wenn einer stirbt – reicht die gesetzliche Erbquote oder soll der überlebende Ehegatte stärker abgesichert werden?
10. Fazit und nächste Schritte
- Heirat schafft Chancen und Pflichten. Wer vorab Steuern, Rente, Unterhalt, Erbrecht, Versicherungen und den Güterstand klärt, vermeidet Streit und Kosten. Ein maßgeschneiderter Ehevertrag gibt Sicherheit, gerade bei Unternehmen, Immobilien, Vermögensunterschieden oder Auslandsbezug.
- Gern bespreche ich Ihre Situation persönlich und entwerfe mit Ihnen eine passgenaue Lösung – vom Ehevertrag bis zur Vorsorge- und Steuerplanung. Melden Sie sich für ein unverbindliches Erstgespräch in unserer Kanzlei. Einen Beratungstermin können Sie hier vereinbaren.
Stand: Januar 2026
Ab welchem Einkommen müssen Kinder für das Pflegeheim zahlen?
Die 100.000-Euro-Grenze schützt die meisten Familien
Wenn die Eltern pflegebedürftig werden und ins Heim müssen, stellt sich schnell die bange Frage: Muss ich als Kind dafür zahlen? Die gute Nachricht vorweg: Kinder müssen in der Regel erst ab 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen Elternunterhalt zahlen. Diese gesetzliche Regelung schützt die allermeisten Familien vor finanzieller Überforderung.
Wann wird Elternunterhalt überhaupt zum Thema?
Die Pflege in Pflegeheimen kostet schnell mehrere tausend Euro im Monat. Die Pflegeversicherung zahlt nur einen Teil, den Rest müssen die Eltern aus Rente und Ersparnissen stemmen. Reicht das nicht, springt das Sozialamt mit „Hilfe zur Pflege" ein. Erst wenn Einkommen und verwertbares Vermögen der Eltern weitgehend aufgebraucht sind, schaut der Staat überhaupt auf die Kinder. Aber nur unter klaren Voraussetzungen.
Die rechtliche Grundlage bildet § 1601 BGB, wonach Verwandte in gerader Linie verpflichtet sind, einander Unterhalt zu gewähren, somit auch Kinder gegenüber ihren bedürftigen Eltern.
Die 100.000-Euro-Grenze: Ihr wichtigster Schutz
Ab dem 01.01.2020 ist wegen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes die Rechtslage entschärft worden. Jeder zahlt nur noch einen Eigenanteil, der begrenzt ist, aber auch zur Voraussetzung hat, dass das Bruttoeinkommen des Kindes 100.000 Euro übersteigt.
Wichtige Eckpunkte der Regelung:
Es zählt ausschließlich Ihr eigenes Einkommen, nicht das Ihres Ehepartners. Liegt Ihr Brutto unter 100.000 Euro, besteht in der Regel keine Zahlungspflicht aus Ihrem Vermögen.
Schwiegerkinder sind rechtlich nicht verpflichtet, Elternunterhalt zu leisten. Vorhandenes Vermögen wird bei der 100.000€-Grenze nicht berücksichtigt.
Was passiert, wenn Sie über 100.000 Euro verdienen?
Elternunterhalt betrifft vor allem sehr gut Verdienende und nicht die breite Mitte. Doch selbst wenn Ihr Einkommen die Grenze überschreitet, bedeutet das nicht, dass Sie Ihr gesamtes Vermögen einsetzen müssen.
Liegt Ihr Einkommen über 100.000 Euro, prüft das Sozialamt, wie viel Ihnen tatsächlich zugemutet werden kann. Dabei wird folgendes berücksichtigt: einen großzügigen Selbstbehalt für Ihren eigenen Lebensunterhalt, anerkannte Ausgaben wie Kredite, Versicherungen, Altersvorsorge sowie Verpflichtungen gegenüber Partner und eigenen Kindern. Sie müssen keine Sorgen haben, dass Ihr komplettes Einkommen dafür verwendet wird.
Beispiel zur Berechnung:
In jedem Falle verbleibt Ihnen aber ein monatlicher Betrag von 1.400 € nach der Düsseldorfer Tabelle als Selbstbehalt (450,- € Miete sind hierin enthalten). Das Einkommen, das über den vorgenannten Betrag hinaus geht, verbleibt Ihnen zur Hälfte.
Wie läuft das Verfahren ab?
Das Amt darf Auskünfte erst verlangen, wenn es konkrete Hinweise auf Einkommen über 100.000 Euro hat. Sie erhalten dann einen Fragebogen zu Ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Sind die Kosten der Pflege so hoch, dass Pflegeversicherung und Rente der Eltern zur Kostendeckung nicht ausreichen, springt zunächst der Sozialhilfeträger ein. Dieser fordert das Geld später jedoch von unterhaltspflichtigen Kindern zurück.
Mehrere Geschwister: Wer zahlt wie viel?
Mehrere Kinder haften zwar grundsätzlich anteilig, praktisch zahlen aber nur jene, die die Einkommensgrenze reißen. Verdient also nur eines von drei Geschwistern über 100.000 Euro, muss nur dieses Kind zahlen – die anderen bleiben verschont.
Gibt es Ausnahmen von der Unterhaltspflicht?
Ja, in besonderen Härtefällen kann die Unterhaltspflicht entfallen oder reduziert werden. Bei schweren Verfehlungen der Eltern – z. B. massive Misshandlung, grobe Vernachlässigung – kann die Unterhaltspflicht sinken oder gar wegfallen.
Praktische Tipps für den Umgang mit dem Sozialamt
Reagieren Sie auf Post vom Sozialamt
Briefe vom Sozialamt nicht ignorieren, aber prüfen lassen. Auch wenn Sie unter der 100.000-Euro-Grenze liegen, sollten Sie auf Anfragen reagieren und Ihre Einkommenssituation darlegen.
Sprechen Sie frühzeitig mit Ihren Eltern
Frühzeitig mit den Eltern über Pflege, Finanzen und Vorsorge sprechen. Je besser Sie vorbereitet sind, desto weniger Stress entsteht im Ernstfall.
Dokumentieren Sie Ihre Einkommensverhältnisse
Halten Sie aktuelle Gehaltsnachweise, Steuerbescheide und Nachweise über Ihre finanziellen Verpflichtungen bereit. Das erleichtert die Kommunikation mit dem Sozialamt erheblich.
Besondere Konstellationen
Selbstgenutzte Immobilie
Der Wert einer selbstgenutzten Immobilie bleibt bei der Bemessung des Altersvorsorgevermögens eines auf Elternunterhalt in Anspruch genommenen Unterhaltspflichtigen grundsätzlich unberücksichtigt.
Altersvorsorge
Sonstiges Vermögen in einer Höhe, wie sich aus der Anlage von 5 % des Jahresbruttoeinkommens ergibt, braucht vor dem Bezug der Altersversorgung regelmäßig nicht zur Zahlung von Elternunterhalt eingesetzt zu werden.
Notgroschen
Zum so genannten Notgroschen, der einem Unterhaltspflichtigen gegenüber der Inanspruchnahme auf Elternunterhalt zusätzlich zusteht. Ein gewisses Schonvermögen bleibt Ihnen also erhalten.
Fazit: Schutz für die meisten Familien
Elternunterhalt ist kein Automatismus, sondern eine klar begrenzte Pflicht für wenige. Die 100.000-Euro-Grenze schützt die meisten Familien vor Überforderung. Solange das eigene Einkommen diese Schwelle nicht überschreitet, müssen in der Regel keine finanziellen Belastungen für die Pflege der Eltern befürchtet werden. Wichtig bleibt jedoch, Unterlagen vom Sozialamt aufmerksam zu prüfen und bei Unsicherheiten fachlichen Rat einzuholen. So bleiben Sie handlungsfähig und wissen genau, welche Rechte Sie haben.
Persönliche Beratung in unserer Kanzlei
Das Thema Elternunterhalt ist komplex und jeder Fall liegt anders. Wenn Sie Post vom Sozialamt erhalten haben oder sich präventiv informieren möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre individuelle Situation, prüfen Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse und entwickeln gemeinsam eine Strategie für den Umgang mit dem Sozialamt. Vereinbaren Sie einen Termin in unserer Kanzlei – wir sorgen dafür, dass Ihre Rechte gewahrt bleiben und Sie nicht mehr zahlen müssen als gesetzlich vorgeschrieben. Hier Termin vereinbaren